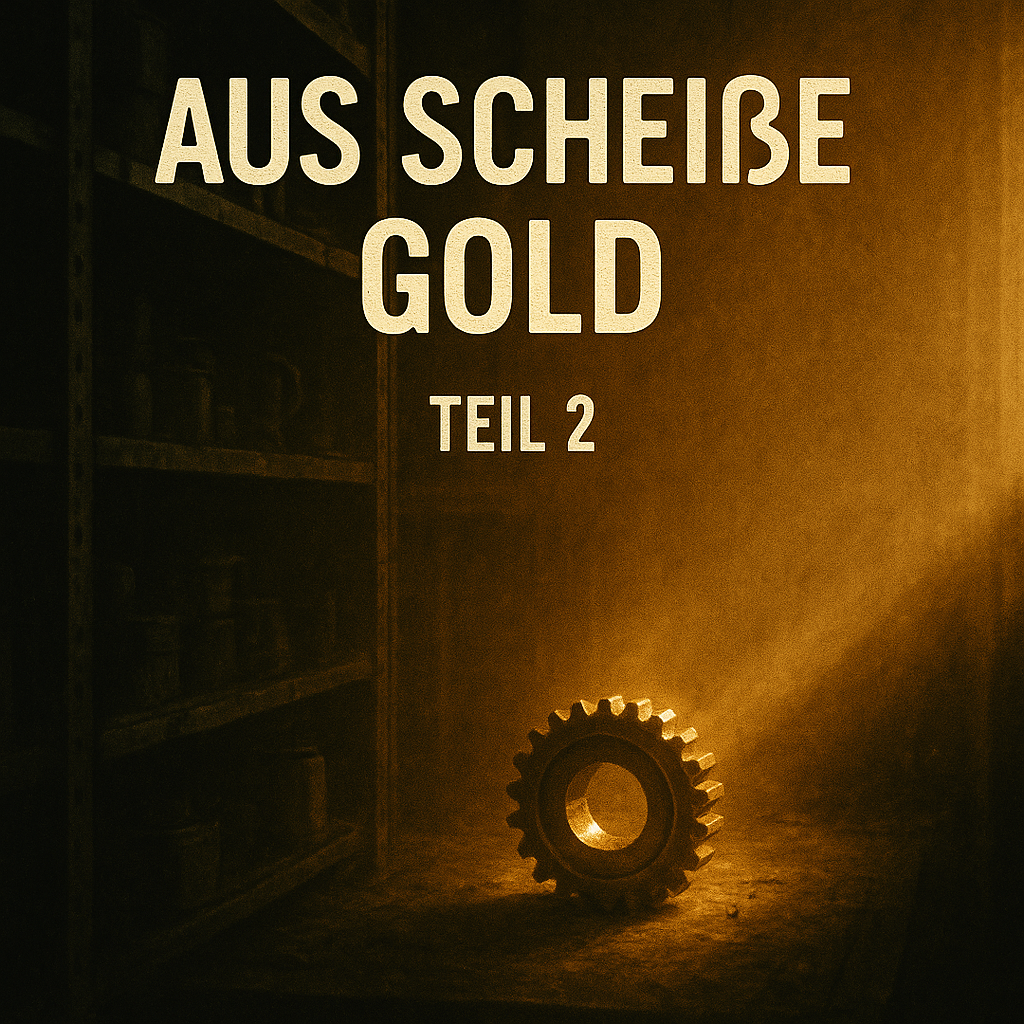Feste im Schatten der Angst: Ein Feuerwehrmann über Sicherheit und Verantwortung
Zunächst möchte ich mein tiefstes Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien ausdrücken, die durch die tragischen Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ihr Leben verloren haben oder verletzt wurden. Solche Vorfälle erinnern uns daran, wie fragil das Gefühl von Sicherheit sein kann und wie wichtig es ist, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern.
Stell dir vor, du bist mit einer Tasse dampfendem Glühwein auf einem festlich beleuchteten Weihnachtsmarkt. Die Luft ist erfüllt vom Duft nach Zimt und gebrannten Mandeln, Kinder lachen, und Weihnachtsmusik erklingt aus den Lautsprechern. Es ist einer dieser Momente, die sich anfühlen wie aus einem Weihnachtsfilm. Doch mitten in dieser Idylle kann sich unbemerkt ein Schatten zusammenziehen, der innerhalb von Sekunden alles verändert. Genau das passierte 2016 in Berlin, 2020 in Trier und nun wieder 2024 in Magdeburg.
Als ehrenamtlicher Feuerwehrmann, der an Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen mitgearbeitet hat, sehe ich solche Vorfälle nicht nur mit Bestürzung, sondern auch durch die Linse meiner praktischen Erfahrung. Wie können wir verhindern, dass Feste, ob Weihnachtsmärkte, Dorffeste oder große Stadtveranstaltungen, zum Ziel von Anschlägen werden? Welche Verantwortung tragen Veranstalter, Behörden und Einsatzkräfte? Lass uns eintauchen – in die oft unsichtbare, aber unglaublich komplexe Arbeit, die hinter den Kulissen der Sicherheit stattfindet.
Die Rolle der Feuerwehr: Mehr als nur Brände löschen
Viele Menschen sehen in der Feuerwehr vor allem die Held:innen, die Brände löschen oder bei Unfällen helfen. Doch unsere Arbeit geht weit darüber hinaus. Sicherheitskonzepte sind ein essenzieller Teil unseres Jobs. Gemeinsam mit anderen Organisationen wie dem Rettungsdienst oder der Polizei denken wir über Szenarien nach, die niemand erleben will, und schaffen Maßnahmen, um diese zu verhindern. Dabei geht es nicht um Heldentum, sondern um Verantwortung und Teamarbeit.
Ich erinnere mich an eine Übung, bei der wir simulierten, was passiert, wenn ein Fahrzeug unkontrolliert in eine Menschenmenge gerät. Es war erschreckend zu sehen, wie schnell Chaos entstehen kann. Doch genau solche Übungen sind wichtig, um vorbereitet zu sein. Nicht, weil wir uns als Held:innen sehen, sondern weil jede:r im Team seinen Teil dazu beiträgt, dass wir gemeinsam handeln und die beste Lösung finden. Im Ernstfall zählen nicht einzelne Entscheidungen, sondern das Zusammenspiel aller Beteiligten. Die Feuerwehr allein kann das nicht leisten, genauso wenig wie der Rettungsdienst oder die Polizei allein.
Dieses Zusammenspiel macht den Unterschied. Es zeigt, dass wir, wenn wir aufeinander abgestimmt arbeiten, nicht nur effektiver sind, sondern auch das Vertrauen der Menschen verdienen, die wir schützen wollen.
Berlin, Trier, Magdeburg: Was wir lernen müssen
Der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz 2016 war ein Schock, der die Sicherheitskonzepte in Deutschland revolutioniert hat. Ein Lkw raste durch die Menge, weil es keine physischen Barrieren gab, die ihn hätten stoppen können. Seitdem wurden in vielen Städten Poller, Betonblöcke oder andere Hindernisse installiert. Doch Trier 2020 zeigte, dass das allein nicht reicht. Hier nutzte der Täter eine unscheinbare Fußgängerzone, um gezielt Menschen zu verletzen und zu töten. Magdeburg hat diesen Albtraum nun wieder wachgerüttelt.
Ich möchte betonen, dass ich das Sicherheitskonzept von Magdeburg nicht kenne und mir auch nicht anmaßen will, alles besser zu wissen. Doch wenn ein Fahrzeug so weit vordringen konnte, muss es wohl eine Schwachstelle gegeben haben. Fehler passieren – und es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen. Vielmehr sollten wir die Gelegenheit nutzen, um zu reflektieren und besser zusammenzuarbeiten.
Eine Möglichkeit wäre smartere Technologie: Kameras, die verdächtige Bewegungen erkennen, oder mobile Barrieren, die bei Gefahr automatisch ausfahren. Auch Schulungen und Briefings für Ehrenamtliche, wie ich sie damals in Westhofen erlebt habe, könnten helfen, Sicherheitslücken zu identifizieren. Ich erinnere mich, wie wir mit dem Einsatzleitwagen (ELW) alle relevanten Szenarien durchspielten und gemeinsam mit Polizei, Rettungsdienst und anderen Organisationen an Lösungen arbeiteten. Dabei haben wir erlebt, wie verschiedene Perspektiven und Erfahrungen die Sicherheit auf ein ganz neues Niveau heben können. Es war, als ob jede:r einen Baustein beiträgt, der am Ende ein solides Fundament ergibt.
Besonders wichtig finde ich die Einbindung ehrenamtlicher Einsatzkräfte – und das gilt genauso für den Rettungsdienst wie für die Feuerwehr. Es gibt viele Ehrenamtliche im Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder anderen Organisationen, die beruflich gar nichts mit dem Rettungsdienst zu tun haben, aber dennoch einen wertvollen Beitrag leisten. Der große Vorteil des Ehrenamtes liegt darin, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen zusammenkommen. Diese Vielfalt ist wie ein Kaleidoskop: Jede Perspektive fügt ein neues Muster hinzu, das uns hilft, kreative und umfassende Lösungen zu finden.
Mit zunehmender Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr, insbesondere den Freiwilligen, haben sich Einsätze in den letzten Jahren merklich verbessert. Gemeinsame Übungen helfen dabei, die Perspektiven des jeweils anderen besser zu verstehen – warum der eine eine bestimmte Anweisung gibt und warum der andere anders handelt. Dieses Verständnis verbessert die Kommunikation und sorgt dafür, dass Einsätze effizienter ablaufen. Klar ist, dass ein Rettungsdienstler keinen Innenangriff durchführen sollte, wenn er dafür nicht ausgebildet ist, und ein Feuerwehrmann sollte keine medizinische Versorgung übernehmen, wenn er keine Ahnung davon hat. Aber genau deshalb müssen wir enger zusammenarbeiten, um die jeweiligen Stärken zu nutzen.
Ein gutes Zusammenspiel mit der Polizei ist ebenfalls entscheidend und sollte häufiger geübt werden. Vielleicht könnte man eine Art gemeinsamen ELW schaffen, der mit je einer Person von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und den Planern des Sicherheitskonzepts besetzt ist. Ein zentraler Funkkreis für das Event würde die Kommunikation enorm vereinfachen. Zusätzlich wäre es sinnvoll, mehr gemischte Teams über das Fest laufen zu lassen – nicht immer nur Polizei oder Rettungsdienst. In Westhofen haben Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam Streifen übernommen, und das hat hervorragend funktioniert.
Ein besseres Zusammenspiel zwischen allen Organisationen – Berufsfeuerwehr, Freiwillige, Polizei, Rettungsdienst und weitere – könnte ein Schlüssel sein, um die Sicherheit auf Festen weiter zu verbessern. Indem wir Ehrenamtliche noch stärker einbinden, schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein Teamgefühl, das uns alle enger zusammenrücken lässt. Denn letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel: Menschen zu schützen und sichere Veranstaltungen zu ermöglichen.
Was können wir tun?
Die Lehren aus Berlin, Trier und Magdeburg sind klar: Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Hier sind einige Ansätze, die wir verfolgen sollten:
- Physische Barrieren verbessern: Poller, Betonblöcke und Fahrzeuge können effektiv sein, müssen aber klug positioniert werden.
- Technologie nutzen: Kameras mit automatischer Objekterkennung könnten verdächtige Bewegungen frühzeitig erkennen. Mobile Apps könnten Besuchenden im Notfall den schnellsten Fluchtweg zeigen.
- Zusammenarbeit stärken: Feuerwehr, Polizei, Veranstalter und Rettungsdienste müssen eng zusammenarbeiten, um alle möglichen Szenarien abzudecken. Besonders wichtig ist die Einbindung von ehrenamtlichen Kräften, die mit ihrer Vielfalt an Berufen und Perspektiven wertvolle Impulse liefern. Gemeinsame Übungen, wie sie in vielen Städten bereits durchgeführt werden, helfen, Verständnis füreinander zu schaffen. Ein Beispiel ist die enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst bei gemischten Streifen oder Einsätzen. Solche Synergien könnten auch auf die Zusammenarbeit mit der Polizei ausgedehnt werden, um eine noch stärkere Einheit zu bilden.
- Bewusstsein schärfen: Besuchende sollten wissen, wie sie sich im Notfall verhalten. Einfache Anleitungen könnten hier viel bewirken.
- Ehrenamtliche stärken: Gerade Ehrenamtliche im Rettungsdienst oder der Feuerwehr bringen oft einzigartige Perspektiven mit, die durch gemeinsame Schulungen und Briefings gezielt eingebunden werden können. Sie können durch ihre Vielfalt helfen, Sicherheitslücken zu erkennen und kreative Lösungen vorzuschlagen.
Warum das alles zählt
Für mich als Feuerwehrmann ist es ein Herzensanliegen, dass Menschen sicher nach Hause kommen. Jede Maßnahme, die wir treffen, jedes Konzept, das wir entwickeln, hat ein Ziel: Leben zu schützen. Doch Sicherheit ist nie absolut. Sie ist ein ständiger Balanceakt zwischen Schutz und Freiheit, zwischen Vorsicht und Leichtigkeit.
Feste – egal ob Weihnachtsmärkte, Dorffeste oder große Stadtveranstaltungen – sind ein Symbol für Gemeinschaft und Freude. Wenn wir alles daransetzen, sie sicher zu machen, können sie genau das bleiben. Und vielleicht denken wir das nächste Mal, wenn wir ein solches Fest besuchen, an die unsichtbaren Schutzengel, die im Hintergrund alles tun, damit wir die Magie unbeschwert genießen können.